Exzellente Typen


Die ersten deutschen Designer, die an der »typografischen Atlantikbrücke« bauten, waren Kurt Weidemann und Olaf Leu. Was war für Dich der Grund, mit den Amerikanern Kontakt aufzunehmen?
Erste Anzeichen eines Interesses an anderem Design entstand 1955 während meiner Jahre bei der Bauerschen Gießerei. Die USA interessierten mich als Land, von deren Design hatte ich keine Ahnung.
Du hast immer die Ansicht vertreten, daß New York in den 50er und 60er Jahren der Design-Schmelztiegel par excellence war. Hitlers Machtergreifung war der Auslöser für die Neue Amerikanische Schule. Aus allen Ländern Europas floh man vor ihr in die USA. Bereits im amerikanischen Editorial-Design der 30er und 40er Jahre kamen die drei Russen, die das moderne Zeitschriftendesign bei Vogue und Harper’s Bazaar geprägt haben: Alexey Brodovitch, Mehemed Fehmy Agha und Alexander Liberman. Im Nachkriegs-Design entstand dann jene europäisch-amerikanische Gestaltung — etwas, was es vorher nie gab. Also keine Renaissance von irgendetwas, sondern eine Revolution.
Mit welchen Gefühlen hast Du die Atlantikbrücke gebaut? Du warst Europäer und somit Teil jener Quelle, aus der in New York die Designwelt neu erfunden wurde. Hast Du als Bürger des »tausendjährigen Reichs« so kurz nach dem Krieg Probleme mit den zahlreichen Kollegen jüdischen Glaubens gehabt?
Über meine politische Unbekümmertheit schrieb 1955 der Engländer Cal Swann nach einem Studienaufenthalt in Frankfurt in der Bauerschen Gießerei: »Der Großteil der Menschen, denen ich begegnete, hatte den Krieg und das pechschwarze Kapitel in Deutschlands jüngster Geschichte immer im Hinterkopf. Sie hielten sich bedeckt und waren stets darauf bedacht, das negative Image der Deutschen aufzubessern. Daher waren sie Ausländern gegenüber fast zu ehrerbietig. Olaf dagegen versuchte nicht, die jüngste Vergangenheit oder die Tatsache, daß er ein Deutscher war, mit Stillschweigen zuzudecken.«
Ich war naiv — »Naivität setzt ungeahnte Entschlußkräfte frei« (Zitat von Kurt Weidemann) — gutgläubig, forsch. Und da die Bauersche Gießerei eine Vertretung in New York hatte, wollte ich diese besuchen. The Bauer Type Foundry in New York reichte den von mir entworfenen Neujahrsglückwunsch – mehr eine kleine Broschüre mit dem Glückwunschtext in mehreren Sprachen und Schriften – zum 3. Jahreswettbewerb des TDC ein. Er wurde mit »excellence« ausgezeichnet. Ich habe darüber keine Urkunde bekommen, die blieb wohl in New York. Aber: Ich bekam diese, mit allen Ergebnissen ausgestattete Broschüre! Das war im Frühling 1957. Und hier begegneten mir zum ersten Mal Designlösungen »made in USA« – und Olafs Arbeit, zwar nicht unter seinem Namen, war dabei!
Diese sichtbaren Ergebnisse lösten in mir den Impuls USA aus, zumindest ahnte ich die Möglichkeiten für mich. Diese Broschüre trug ich von besagtem Frühling bis zu meinem selbständigen Start im Januar 1959 mit mir herum und begann dann die Strukturen der abgebildeten Arbeiten in meinem Design nachzubilden. Meine Selbständigkeit brachte nun viele Arbeiten hervor, die stark an dem angelehnt waren, was ich in der TDC-Broschüre so vorgeführt bekam.
Ich finde es interessant, daß man damals keine Scheu hatte, abzukupfern. Herb Lubalin schreibt in der Mai/Juni-Nummer von Print 1979: »Als Student stand ich unter dem Einfluß von Paul Rand. Ich sah die beste Lernmethode im Plagiat. Ich glaube, ich habe jedes einzelne Design ausgeliehen, das Paul Rand jemals entwickelt hat. Paul Rand war der Pablo Picasso der Grafik.«
Bist Du mit überlegenen oder Minderwertigkeitsgefühlen nach New York gefahren? Warst du staunender Bewunderer oder selbstbewußter Europäer, also Angehöriger jener Welt, die mithalf, den neuen Stil zu ermöglichen?
Ich bin weder mit überlegenen noch mit Minderwertigkeitsgefühlen in die USA gereist. Immerhin wurde ich ja schon einmal vom TDC ausgezeichnet, das werde ich sehr wohl erwähnt haben, und ich hatte gerade in diesen frühen Sechzigern schon eine ganze Reihe von frischen Arbeiten. Also, ich denke, ich war eher ein selbstbewußter, junger Deutscher, unversehrtes Kriegskind einer kriegsversehrten Nation. Keine Skrupel, auch keine Schuldgefühle. Ich war offen, neugierig, kollegial eingestellt, so daß die Glaubensrichtungen der Kollegen anderer Nationen keine Rolle spielten. Ich denke, das strahlte ich auch aus, denn sonst hätten mich wohl die israelischen Designer 1968 nicht zu ihrem ersten Kongress eingeladen. Ich kannte keine Diskriminierung, für mich war jede Nation zuerst mal interessant.
Als Kurt Weidemann, den ich durch den »Druckspiegel«, an dem ich mitgearbeitet habe, kannte, 1957 nach USA reiste, traf er dort Klaus F. Schmidt, den Deutschen, der seit 1951 in den USA lebte, der zusammen mit Aaron Burns 1961 das ICTA (The International Center for the Typographic Arts) gründete. Klaus F. Schmidt war 1963 auf ICTA-Deutschland-Tour – so lernten wir uns kennen – und ich folgte im Oktober 1964 seiner Einladung.
Warst Du in New York Ideen-Geber oder Ideen-Empfänger?
Nun, das hält sich wohl die Waage. Den TDC oder den ADC nach Europe zu exportieren, das war meine Idee gewesen. Mit meinen Arbeiten (auf Dias vermittelt), konnte ich später bei meinen Besuchen im TDC so manchen kollegialen Beitrag leisten. Es war ein Zeigen und Empfangen.
Warum hat Dich Aaron Burns eingeladen?
Er hatte mir 1957 geschrieben. Die Empfehlung kam von Eberhard Hölscher, dem Präsidenten des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker und Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift »Gebrauchsgraphik«. Ich begegnete Burns dann später im TDC. Durch die Vermittlerrolle von Klaus F. Schmidt wurde ich ihm vorgestellt. Er war ein freundlicher, mir sehr zugetaner Kollege. Burns war überhaupt der Treiber, Klaus F. Schmidt war aktives und deutschsprachiges Mitglied in seinem Team, somit die ideale Voraussetzung für eine internationale Zusammenarbeit.



Der Type Directors Club of New York war bei seiner Gründung eine elitäre Veranstaltung. Mitglied konnte man nur auf Empfehlung werden. Heute wird jeder, der den Aufnahmeantrag ausfüllt und den Mitgliedsbeitrag bezahlt, aufgenommen. Der Wandel hatte ja nichts mit dem heutigen Gleichmacherei- und Quoten-Terror und der Eliten-Despektion zu tun. Was war der Grund für die Öffnung?
Von außen gesehen, entstand der Eindruck einer Elite. Dem muß ich allerdings widersprechen. Es waren Tätige, Interessierte, letztlich Kollegen, die sich hier fanden. Nicht jeder war prominent, erst 1955 mit der Gründung eines Wettbewerbs kamen die Prominenten, von denen viele später auch zu Mitgliedern wurden. Man kann die Gründung eines Clubs – vorwiegend für Angehörige der in der Madison Avenue residierenden Werbeagenturen – aus heutiger Sicht als eine gelungene Marketingmaßnahme der damals schon gewichtigen und einflußreichen Layoutsetzereien bezeichnen. Man versammelte seine Kunden, die tagaus, tagein ihre Bestellungen aufgaben. So wie bei der führenden Layout- bzw. Fotosetzerei »Photo-Lettering«, quasi ein Reprobetrieb, dessen Inhaber Ed Ronthaler hieß, der noch als Hundertjähriger die Clubmeetings besuchte.
Man brachte ein Schriftangebot in Telefonbuchstärke unter seine Kunden. Sicher ist Ed Ronthaler einer der Ziehväter der Idee eines Clubs, denn er kannte und versammelte seine Kunden, indem er ihnen eine Heimat gab. Eine weitere Marketingmaßnahme war die der Galerien. Dazu dienten die Vestibüle, die Vorräume, die mit Ausstellungswänden bestückt wurden, als meeting point für gelegentliche Empfänge, sprich Ausstellungseröffnungen. Auch dies waren Heimaten, Treffpunkte für Kunden, aber auch Nichtkunden der Szene. All diese Aktivitäten schufen eine, an Schriften und ihrer Anwendung interessierte Gemeinde. So war dann die Idee, daraus auch einen Club zu gründen, nur noch ein kleiner Sprung.
Und diese Gemeinde war zwar keine Elite, aber ein relativ kleiner Kreis.
Man kannte sich, man sprach miteinander, man hatte dieselben Beweggründe, man versuchte sich einig zu werden. Dieses Miteinander, nun in eine Clubform gegossen, erzeugte eine Limitierung des Kreises. Man wollte wissen, auf wessen Engagement in der Sache man bauen konnte, also waren Empfehlungen, Patenschaften, wer dafür geeignet und akzeptiert werden könnte, Usus. Zumindest in den ersten 20 Jahren.
Man bedenke die Tatsache, daß der Type Directors Club in seiner ersten Dekade ein rein lokaler, auf lokal beschränkten Verbindungen basierender, personell auf wenige Personen, beschränkter Club war. Es war nichts anderes als was man heute mit einem Stammtisch bezeichnet. Und wer hier geladen war, der mußte bekannt sein, um akzeptiert zu werden. Die erste Dekade des TDC galt der »Education«, Seminare und Vorträge über die Materie Schrift und Design, ein ambitioniertes, äußerst aktives Programm und dieses hielt den Club in seinem selbstgestellten Auftrag überhaupt zusammen. Ansonsten wäre es bei einem Debattierclub geblieben, Modell Stammtisch.
Zu der Zeit gab es noch keine Wettbewerbe?
1955 wurde clubintern ein Wettbewerb veranstaltet. Man sollte eigene Arbeiten einreichen und die Ergebnisse einer Jury wurden per Dia an die Wand geworfen. Daraus wurde dann 1956 der zweite – jetzt öffentlich ausgeschriebene – Wettbewerb, die Geburtsstunde der Type Directors Show. Mit dem Wettbewerb hatte man bewußt oder unbewußt eine neue Ära eingeleitet, denn plötzlich wurden aus der reinen Theorie der »Education« sichtbare Ergebnisse. Und zudem nicht nur von einer bislang kleinen Mitgliedschaft, sondern auch von vielen Einsendern außerhalb von New York. Damit wuchs auch die Mitgliederzahl, und hier kam, aufgrund der jetzt sichtbaren Ergebnisse, auch der Gedanke der Elite auf. Das Prinzip der Empfehlungen, der Patenschaften, für eine Mitgliedschaft wurde in dieser Phase noch beibehalten.
Obwohl auch außerhalb von New York Einreichungen möglich waren, blieb der Club auf die USA beschränkt?
Der Wettbewerb war in den ersten Jahren auf Einsendungen ausschließlich amerikanischer Autoren beschränkt. Eine Lockerung, auch Einsendungen außerhalb der USA zuzulassen, war erst 1965 zu verzeichnen und nur für akzeptierte Mitglieder. Damit hatte man bewußt oder unbewußt die Büchse der Pandora geöffnet. Denn jetzt wollten Kreative aus Nah und Fern Mitglied im TDC werden, denn das war von außen gesehen, die Elite.
Bis 1990 war meines Wissens die Mitgliedschaft limitiert. So wie beim Art Directors Club. Danach wurde, übrigens bei beiden dieser Clubs, diese Limitierung aufgehoben. Jetzt diente man nicht einer Idee, sondern der Clubkasse. Und die füllte sich, dank des Gedankens, jetzt einer Elite anzugehören. Nicht die Akzeptanz eines Werkes, nein – eine Unterschrift unter ein Antragsformular genügte.
Wann bist Du im TDC aufgenommen worden?
Das war 1965. Der TDC war, wie erwähnt, ein lokaler Club, der seine wöchentlichen Mittagessen im gemieteten Nebenzimmer des Roger-Smith-Hotels nahe Grand Central Station abhielt. 1964 als damals 28-jähriger erkannte ich die Chance den TDC aus seinem bisherigen, auf die USA beschränkten, Umfeld herauszulösen und ihn international wirken zu lassen. Durch Fürsprache des unermüdlichen Aaron Burns und Klaus F. Schmidt gab man die Show – es war die elfte – erstmals für den Export außerhalb der USA frei.
Damit kam es dann zur erwähnten Öffnung der Büchse der Pandora. Denn Eifersucht, Ehrgeiz, Gerangel ›»Wer-denn-nun-Elite-sei«, erhielt ungehemmten Auftrieb. Unter Jerry Singleton, einem Sekretär in Gestalt einer Sekretärsfigur aus einem Fritz-Lang-Film, war der TDC ein – nach wie vor – großer New Yorker Schrift-Stammtisch, wo man sich austauschte. Gemütlich, kollegial, mit all den Einladungsdrucksachen, wenn ich dort auftrat.
Der Wettbewerb passte eigentlich nicht in das bislang gepflegte Ambiente, das nach wie vor, und später noch viel mehr, aus den freundlichen »Hellos-how-are-you« unter Kollegen bestand. Plötzlich mußten Juroren benannt werden, sieben an der Zahl, und ab und zu ein Ausländer. Die Juries kamen damals aus dem Clubverzeichnis.
Du hast mir die ersten 25 Jahresbroschüren (Bild 3, 4) aus deinem »Nachlaß zu Lebzeiten« übergeben. Sie sind in der Sammlung Moser, Unterabteilung »Olaf Leu Collection« archiviert. In diesen Jahresbroschüren wurden die Mitgliederlisten veröffentlicht.
Richtig! Und plötzlich gabs eine Kasse: Einsendegebühren und Veröffentlichungsgebühren. Als dann immer mehr dem TDC beitreten und mit am Tisch der Elite sitzen wollten, gab’s zwar noch die Empfehlungen und Patenschaften, aber die Wenigsten konnten am täglichen Leben des TDC in New York real teilnehmen. Insofern eine Nonsens-Mitgliedschaft, aber die Eitelkeit und der Ehrgeiz, unbedingt dazuzugehören, war nicht mehr zu bremsen.
Würde das Nobelpreis-Komitee Mitglieder aufnehmen – was sie Gottseidank weder tun noch erwägen – wäre auch hier der Zustrom immens. Singleton starb und Carol Wahler, eine bisherige Immobilienverwalterin, kam zum Zug. Und sie verwaltete die bestehenden Einheiten. Von »Education« und Seminaren, einer idealistischen Form, war nichts mehr – oder kaum noch etwas – vorhanden. Carol war (und ist) Geschäftsfrau und der Wettbewerb war pure Kohle. Und da der Hunger nach »certificates for excellence« immer größer wurde, zudem dann jegliche Mitgliedschaft möglich wurde, wurde das die Cash-Cow. Carol befriedigte die Nachfrage. Das tat sie, größere Einheiten wie Häuser gewohnt, sehr clever und die zweijährigen, regelmäßigen Wachwechsel des Vorstands ließen immer weniger Erfolg und Stringenz einstmaliger, unverwechselbarer Identity zu.
Der Club, ursprünglich voller Ideale, hat die Säkularisierung unserer Zeit nicht überstanden. Das Innere wurde ausgeräumt. Was stehen blieb, ist die äußere Gestalt einer angesehenen, auf historischem Kapital basierenden, Adresse.


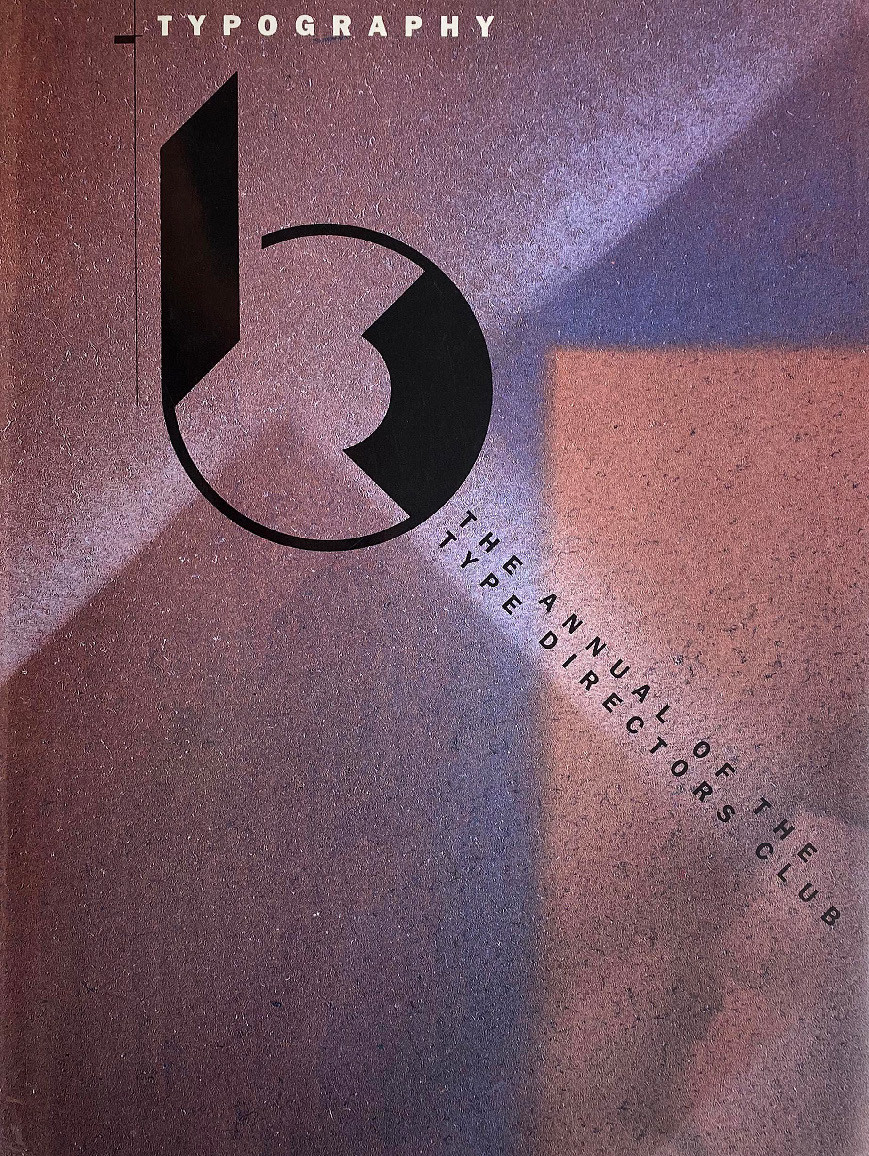
Nach den Broschüren kamen die Annuals in Buchform.
Bis 1979 wurden die Wettbewerbsergebnisse in schwarz-weiß gedruckten Broschüren dokumentiert. Es sind jene 25 Broschüren, die Du erwähnt hast. Danach wurden die Ergebnisse zu einem Verlagsobjekt in Buchform. Man begann mit der Ziffer eins. Eigentlich war es die 26. Folge. Die Verlage wechselten, zumal hohe Auflagen im Verkauf nicht erreicht wurden. Irgendwann war es dann soweit, daß kein amerikanischer Verlag mehr das Risiko einer Herausgabe wagen wollte. So wurde in letzter Sekunde der deutsche Verlag Hermann Schmidt aus Mainz zum rettenden Hafen. In den USA vorlagenmäßig geschaffen, in Asien gedruckt und schließlich in Mainz verlegt.
War die jährlich beauftragte Jury, deren Zahl konstant bei sieben Mitgliedern blieb, in den ersten Jahren meist von prominenten Namen geprägt, verlor sich das mehr und mehr. Prominenz spielte keine Rolle mehr, die Namen kannte eh keiner, so daß sieben, in jedem Jahr wechselnde Juroren ihren Zeitgeschmack an den zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten dokumentieren konnten. In jedem Jahr entstand ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Ausformungen, an denen nur noch das Diktum Mainstream festgemacht werden konnte. Das Bullerbü des internationalen Grafik-Designs. Ein Vorlagenbuch für alle am Mac Tätigen around the world — vergleichsweise Burdas Schnittmustervorlagen für die moderne Frau.
Der TDC nur noch Denkmal, wie das Empire State Building, eine Ikone. Das mag der unerbittliche Lauf der Zeit sein. Der TDC in seinen ersten Jahren hatte jenen Zauber, der sprichwörtlich jedem Anfang innewohnt.
Ich war selten in Juries, weil ich wegen schlechter Erfahrungen nicht teilnehmen wollte. Der Grund lag darin, daß es keine Bewertungskriterien gab. Geht es um Innovation, Vermittlungsqualität, Originalität, Radikalität usw.? Oder ist der individuelle Geschmack eines Jurymitglieds entscheidend? Wie kann man solche Fehlentwicklungen vermeiden? Wie sollen Juries zusammengesetzt werden?
Ein Schiedsrichter der FIFA muß 300 Regeln im Kopf haben, also muß er trainiert und ausgebildet sein, ehe er Spiele richten darf. Und kann. In unserer Branche – weil weiche Masse – gibt es diese Regeln nur in ganz speziellen Wettbewerben. Da wären die »50 Schönsten Bücher der BRD«, schon 1950 mit einem präzisen Regelkatalog der Bewertungskriterien ausgestattet. Das sollte einmalig bleiben.
Einspruch, Herr Professor! Auf meine Frage an die langjährige Leiterin dieses Wettbewerbs, warum es so große Unterschiede in der Bewertung beim deutschen und europäischen Wettbewerb gäbe, obwohl – wie Du sagst – die Kriterien so ausgetüftelt sind, antwortete sie, daß das ja das schöne sei, daß die eine Jury das gleiche Buch zum Sieger kürt und die andere das gleiche Buch bereits in der Vorrunde aussortiert.
Ich fand diesen Wettbewerb immer fragwürdig, obwohl ich auch Preise für Bücher, die Verlage für mich eingereicht hatten, gewonnen habe. Es herrscht eine absurde ideologische Verherrlichung der Manufaktur. Das Kleine, das Studentische, das »liebevoll« selbstgebastelte Lesebändchen als Ideal.
Trotzdem habe ich mir die »Bücherregeln« zum Vorbild genommen, als ich 1995 vor der Frage stand, Kriterien für die Beurteilung von Annual Reports aufzustellen. Auch die Jahreskalender im Gebrauchsgraphik/novum-Jahreswettbewerb wurden zumindest in Anforderungs-Segmente geteilt, jedes Segment einzeln aufgerufen bzw. bewertet. Das funktioniert dort einigermaßen beschwerdefrei, wo es sich um eine einzige Materie handelt, also Reports, Bücher, Kalender, Flaschen. Hier ist das Fachwissen eines Jurors gefragt und das einzige Kriterium ist, die Jury so zusammenzustellen.
Da versagen die meisten Veranstalter, weil sie zu faul oder beim Auffinden von geeigneten Personen im Spezl-Denken gefangen sind. Wo ein Regelkatalog nicht funktioniert, ist bei der Vielfalt eingesandter Medien in Jahreswettbewerben. Das alles ist zu unterschiedlich und nicht über einen Kamm zu scheren. Hier ist der Prominente mit der meisten Erfahrung, Weitsicht und Haltung gefragt.
Nach diesem Prinzip waren die ersten TDC-Juries besetzt. Man legte Wert auf Namen. Ein TDC-Juror mußte aufgrund seiner Prominenz, wo auch immer die herkam, dieser Schiedsrichter in FIFA-Qualität sein. Denn er wußte um Innovation, Vermittlungsqualität, Originalität aufgrund seiner Erfahrungen und seiner Arbeiten! Er erkannte Doubletten, dieses Wischi-Waschi-Design. Der TDC nahm sich Personen, die schon gezeigt hatten, was sie konnten. Ich war im 18. und 30. Jahreswettbewerb des TDC Juror. Durfte auch ein TDC-Jahrbuch gestalten.

Der blaue Rücken beißt sich zwar etwas mit dem rostfarbigen Cover, anyway … Gab es Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Juries?
Das besondere, das ungewöhnliche – für mich als gesprächsbereiten Deutschen – war diese amerikanische Art zu jurieren. Nämlich lautlos! Ohne sich mit seinem Kollegen über eine Arbeit zu unterhalten, abzustimmen. Das ging gar nicht. Du bliebst mit deinem Urteil allein indem du einen Chip in das Sammelgefäß stecktest.
So war es auch beim ADC, der per Klick — yes or no — eine Arbeit, Filme, auf der Leinwand vorstellte, ohne Kommentar, dann Aufforderung zum Klick, ein Handgerät, das jeder Juror bekam. Immer wurde dein Urteil gefragt, aber ohne Berührung mit anderen Meinungen! Eine gerade zu teuflische Verantwortung tut sich da auf.
Anders in Old Germany. Die hatten eben immer gern ihren Napoleon. Das war Günter Gerhard Lange genauso wie Kurt Weidemann – und bei den ADC-Leuten waren es die Vorstände. Es wurde immer Politik im Vorfeld und vor einer Abstimmung gemacht. So in Stuttgart bei den Internationalen Kalendern oder beim DDC, der zwar Spezialjuries, Segmente betreffend, einsetzte – aber das Ergebnis geschah immer in Abstimmung mit allen Beteiligten, nach teilweise sehr interessanten Redebeiträgen. Also, der Knuff in die Seite des Kollegen, sich meinem Urteil anzuschließen … naja, manche tun sich schwer darin, eine Meinung zu bilden.
Die TDC-Juries waren sicher auch nicht frei von persönlichen Vorlieben.
Da keine ausgesprochene Prominenz mehr greifbar war – vielleicht schon in Rente oder als Juror verbraucht – beauftragt man jetzt Personen aus der Szene, die bislang brav ihre Arbeit taten, nie auffielen — und heutzutage schon gar nicht mehr. Und diese Vorlieben ohne Gesamtkonzept kommen dann deutlich zum Tragen. Hier ist dieses lautlose Prinzip geradezu Gift, denn keiner schreit »Stop«, jeder steckt seinen Chip in seine Liebhaberei! Ohne Gegenwehr! Davon zeugen diese Bücher. »Bullerbü« habe ich sie genannt.
Vor fünf Jahren lautete Dein Befund über die Arbeitsweise der Gestalter: »Man glotzt auf eine beleuchtete Scheibe, daneben liegen – mit Post-its versehen – die neuesten Vorlagenbücher, die Jahrbücher des ADC of NY, des TDC of NY, dazu einige englische und amerikanische Szenemagazine.«
Heute sind es die Bildersammlungen der digitalen Speicherhäuser Instagram, Pinterest etc. Haben die Annuals nicht dazu verführt, alles abzukupfern, sich gedanklich mit einem Thema nicht auseinanderzusetzen, sondern vorgefertigte Lösungen zu übernehmen? Hat diese Orientierung an den besten Beispielen das Niveau insgesamt erhöht oder nicht? Muß man den Einheitsbrei der Imitatoren und Follower beklagen?
Was machen die, die so verschieden, schlecht, mittelmässig, gut, sehr gut ausgebildet wurden, jetzt mit dem, was sie scheinbar gelernt/kennengelernt haben? Sie pausen ab. Müssen abpausen! Denn der Speicher ist entweder ein bissle voll oder immer noch leer. Das muß erst noch heranwachsen. Bei dieser jetzigen Ausbildung, bleibt denen gar nichts anderes übrig! Woher sollens die denn haben? Also, dann mal kräftig in Vorlagenliteratur investiert. Alle Verlage haben sich auf diese Bedürfnisse eingerichtet.
Ich bin immer von der Theorie ausgegangen und kann sie immer und immer wieder nur wiederholen: Gute Arbeiten sind Einzelstücke, die einmalig sind und bleiben. Es ist aber reizvoll, sie nachzuahmen. Und bei dieser unaufhörlichen Massierung des Berufes ist das Nachmachen geradezu vorgesehen, denn anders fände diese Masse nie Zugang in den Mainstream! Also: keine Lösung des Abkupferns in Sicht, das gehört inzwischen zum guten Ton …
1989 hast Du aus den prämierten Typo-Arbeiten der ersten 40 Jahre des TDC einen Extrakt der »allerbesten« Arbeiten ausgewählt und in einem Katalog vorgestellt. Ein paar dieser Besten-aller-Zeiten-Designs hast du im dreidimensionalen Linotype-Magazin nochmal versammelt. Wenn man diese Bestleistungen heute betrachtet, fällt auf, daß man der von Dir so bezeichneten Kategorie »Semantische Typografie« die meisten Beispiele zuordnen kann. Eine bekannte Arbeit ist Tango von Oswaldo Miranda. Das »A« besteht aus einem Tango-tanzenden Paar. Diese Methode ist tausendfach kopiert worden. Die Inflation der Kopien erzeugt letztlich Banalität und mindert womöglich auch die ursprüngliche Kreation. Muß man sich vor Rezepten dieser Art hüten?
Diese einmaligen Wortbilder — ob von Miranda oder von Lubalin — waren die Sahnestücke einer Entwicklung, die auf die Sechziger- und Siebzigerjahre beschränkt blieb. Sie waren in ihrer Idee des Werkstücks einmalig, aber reizten zum Nachmachen. Ich habe sie als Beispiele in der damaligen Linotype-Show zur Geltung gebracht. Ob einmalige Werkstücke Rezepte darstellen? In gewisser Weise schon, aber das Gesehene reizt immer zur Wiederholung. Vorbilder haben immer eine rezeptive Wirkung.
Unter den Auszeichnungen findet man keine schlichte typografische Buch-Doppelseite. Paul Renner hat sich mit diesem Thema sehr eingehend beschäftigt. Meisterschaft in dieser nuancenreichen Disziplin kann kein Laie erreichen, wohingegen der Entwerfer des prämierten Schriftzugs Solidarność von 1981 als anonym bezeichnet wird.
Solidarność kam durch meine Initiative als Einsendung zum Wettbewerb. Allerdings sollte und konnte der Entwerfer – ausschließlich aus politischen Gründen – nicht genannt werden. Leider ist das nie berichtigt worden. Der Type Directors Club und sein Wirken entstand im und aus dem Umfeld der Werbeagenturen. Bücher und deren grafische Aufbereitung waren nicht im Zielfeld der Werbung. Für Bücher gab es wie in Deutschland einen eigenen Wettbewerb. Generell: Unter Typography und den beim TDC publizierten Lösungen handelt es sich um Kommunikationsdesign oder Grafikdesign und nicht um Typografie in engerem Sinn. Insofern ist die amerikanische Bezeichnung »typography« grenzwertig.
Generell: Daß Werber ihr Tun als Kommunikationsdesign bezeichnen, ist absurd. Der Begriff »Kommunikationsdesign« für alle Varianten der Gestaltung ist falsch. Kommunikation findet zwischen zwei oder mehreren Menschen (neuerdings auch zwischen Maschinen) statt. Es handelt sich um Informationsaustausch. Aus dem einseitigen Senden von Botschaften kann wechselseitige Kommunikation entstehen. Aber zunächst gibt es einen Absender, der mit seiner Botschaft gehört oder gesehen werden möchte. Bei der Werbung wäre Propaganda oder Reklame nach wie vor der korrektere Ausdruck. Daß mir beim Wort »Propaganda« immer gleich die Dylan-Zeile »Propaganda, all is phony« einfällt – das nur nebenbei.
Noch ein letzter Punkt: Du hast mal erwähnt, daß die TDC-Original-Arbeiten noch erhalten sind.
Ich habe das Material aus den umfangreichen Sammlungen des Type Directors Clubs in die Obhut des Deutschen Plakat Museums in Essen gegeben. Aber die Museumsleitung kommt ihrem ursprünglichen Auftrag und der Verpflichtung nicht nach. Es gibt keinen Vermerk der Archivierung, die Sammlung bleibt unerwähnt. Diese Verschluderung ist ein Skandal!

Anmerkung der Redaktion:
Die Schreibweise dieses Textes wurde vom Autor bewußt so gewählt — »naturbelassen, unbehandelt, frei von Giftstoffen« — und von uns nicht geändert.